Unser Konzept
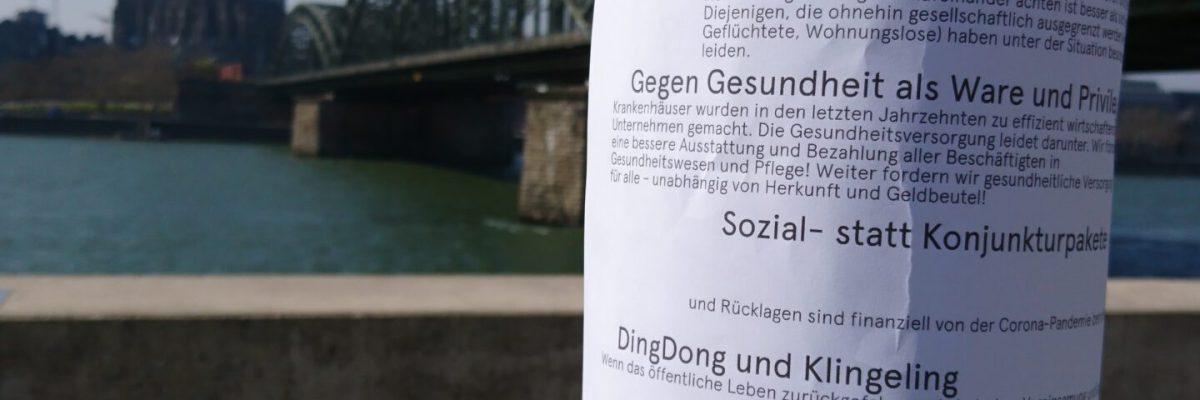
Wir sind eine Gruppe, die beabsichtigt, ein Stadtteilgesundheitszentrum (SGZ) aufzubauen.
Bei uns sind Menschen aktiv, die sich beruflich, persönlich und politisch mit den Themen Gesundheit und Gesundheitsversorgung beschäftigen. Als Expert*innen für z.B. Stadtteilarbeit, Psychologie, Recht, Naturheilkunde und Medizin sind wir täglich mit den Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten der aktuellen Gesundheitsversorgung konfrontiert. Die Erfahrung, dass gesundheitsrelevante Aspekte in allen gesellschaftlichen und politischen Bereichen, wie z.B. Klima, Wohnen, Arbeiten oder Bildung, relevant sind, motiviert uns, aktiv an der Veränderung krankmachender Verhältnisse zu arbeiten. Auf diese Weise wollen wir die grundlegenden Ursachen von Erkrankungen ebenso wie ihre gesundheitlichen Folgen bekämpfen.
Ob Menschen gesund oder krank sind, hängt nicht nur von ihrem individuellen Verhalten und ihren körperlichen Voraussetzungen ab, sondern auch von den gesellschaftlichen Verhältnissen, in denen sie leben. Wer arm ist, ist häufiger krank und lebt kürzer. Ungleichheit bei Einkommen, Wohnverhältnissen, Umwelteinflüssen, Arbeitsbedingungen und Bildung sowie Rassismus und verschiedene Formen von Diskriminierung sind soziale Determinanten von Gesundheit.
Gering entlohnte Beschäftigungsverhältnisse gehen meist mit prekären Arbeitsbedingungen einher, die wiederum durch fehlende Selbstbestimmung und Entscheidungsmacht, monotone Abläufe und/oder körperliche Belastung gekennzeichnet sind. Dies führt zu Stressreaktionen im Körper, die langfristig zu chronischen Erkrankungen führen (Bluthochdruck, Diabetes, Depression etc.). Schlechte Luft (z.B. durch erhöhte Feinstaubbelastung) führt langfristig zu Atemwegserkrankungen (Asthma, COPD etc.) und einem früheren Tod.
Gibt es keine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr oder andere Formen der Mobilität, geht viel Zeit für Wegstrecke verloren, die an anderer Stelle im Leben fehlt (Zeit für soziale Kontakte, Schlaf, Kochen, Sport etc.).
Rassismus sowie Diskriminierungen aufgrund von Geschlecht, Alter, sexueller Identität etc. bedrohen nicht nur direkt die körperliche Unversehrtheit von Menschen, wenn sie körperlich angegriffen werden. Durch Ausgrenzung wird fehlende Zugehörigkeit vermittelt, was ebenfalls zu chronischen Stressreaktionen führt. Die Sorge um die eigene Existenz – sei es durch finanzielle Sorgen, Angst vor der Abschiebung oder häusliche Gewalt – versetzt den Körper in dauerhafte Alarmbereitschaft. Dies löst im Körper ähnliche Stresskaskaden aus, die die oben erwähnten Folgen haben.
Dies sind nur einige Bespiele dafür, dass Armut und Krankheit kein individuelles Versagen sind, sondern ein strukturelles, gesamtgesellschaftliches Problem. Die gesellschaftlichen Verhältnisse hinterlassen einen Fußabdruck auf dem menschlichen Körper.
Ein Ort, der zu Gesundheit arbeitet, muss diese sozialen Determinanten einbeziehen und ändern wollen. Da genau dies unserer Erfahrung nach zu wenig passiert, braucht es neue gesundheitsfördernde Strukturen: Wir setzen uns für einen Ort ein, an dem u.a. Pfleger*innen, Mediziner*innen, Sozialarbeiter*innen, Aktivist*innen, Jurist*innen, Heilpraktiker*innen kollektiv, interdisziplinär und hierarchiearm zusammen mit den Menschen im Stadtteil bedarfsorientiert und niederschwellig arbeiten. Dabei ist uns wichtig, offen mit Anregungen und Ideen umzugehen, die im Austausch u.a. mit Menschen aus dem Veedel, politischen Gruppen sowie Strukturen des öffentlichen Lebens entstehen.
Wir verstehen unser Projekt als Form gelebter Solidarität und als eine politische Aufgabe. Wir möchten ein gutes, selbstbestimmtes und würdevolles Leben für alle Menschen erkämpfen. Es ist uns wichtig, ökonomisch und politisch möglichst unabhängig zu sein und zu bleiben.
Mit der systemkritischen Auseinandersetzung um Gesundheitsversorgung stehen wir nicht allein da. Als Teil des städteübergreifenden Netzwerkes Polikliniksyndikat sind wir mit anderen Gruppen in Deutschland vernetzt, um gemeinsam konkrete Alternativen zur jetzigen Gesundheitsversorgung zu entwickeln. Dabei soll über die Projekte hinaus ein gesellschaftlicher Prozess angestoßen werden, der die Überwindung krankmachender Verhältnisse zum Ziel hat. Auch in anderen Ländern, wie z.B. Griechenland (Solidarity Social Medical Center), Belgien (Médecine pour le Peuple) und dem Libanon („Migrant community center“) haben sich Alternativen zum aktuellen System der medizinischen Gesundheitsversorgung gegründet. Die Vernetzung mit diesen Projekten ist Teil unserer Arbeit.
DAS AKTUELLE GESUNDHEITSSYSTEM – FEHLER IM SYSTEM
Wirtschaftliche Interessen
Unser derzeitiges Gesundheitssystem wurde in den letzten Jahrzehnten zu einem Gesundheitswesen entwickelt, das von ökonomischen Interessen gesteuert ist. Die Idee eines solidarischen und gemeinwohlorientierten Gesundheitssystems wurde dabei zunehmend zurückgedrängt. Alle Bereiche gesundheitlicher Versorgung unterliegen einer drastischen Ökonomisierung und Privatisierung.
Die Akteur*innen des Gesundheitssystems werden also behandelt wie Unternehmen, die in dauernder Konkurrenz stehen, Kosten reduzieren und Gewinne erzielen müssen. In der kapitalistischen Marktwirtschaft sind Kostenoptimierung und Gewinnsteigerung so wichtig, dass der Blick auf die sozialen Determinanten von Gesundheit und Krankheit nicht ausreichend möglich ist. Die Strukturen innerhalb des Gesundheitssystems funktionieren – gewollt oder ungewollt – längst im Sinne dieser Logik. Wo Krankenhäuser Teil gewinnorientierter Konzerne werden, werden Angestellte ausgebeutet und Patient*innen zu Fallpauschalen. Auch im ambulanten Sektor führt die Ökonomisierung zu einem Nebeneinander von Unter-, Über- und Fehlversorgung. Die aktuelle Gesundheitsversorgung orientiert sich also weniger am tatsächlichen Bedarf als an ökonomischen Überlegungen. Die grundlegenden Rechte von Patient*innen auf eine bedarfsgerechte Versorgung werden damit ausgehöhlt.
Die Aufspaltung des Gesundheitssystems in isolierte, überwiegend betriebswirtschaftlich handelnde Akteur*innen in unterschiedlichen Sektoren führt zu Konkurrenz und knappen ökonomischen Ressourcen. Dies zeigt sich besonders deutlich an der Zwei-Klassen-Krankenversicherung und der unzureichenden staatlichen Verantwortung für die Aufrechterhaltung, Weiterentwicklung und Finanzierung des Gesundheitssystems.
Einfache, kostengünstige und nicht-gewinnorientierte Methoden, wie z.B. die sprechende Medizin und präventive Maßnahmen, werden an den Rand des Versorgungsalltags gedrängt, da sie sich kaum ökonomisieren und so wirtschaftlich ausbeuten lassen.
Das Wohlergehen der Patient*innen gerät dabei notwendigerweise aus dem Blick. Die marktgerecht umstrukturierte Versorgungslandschaft trifft die Vulnerabelsten unserer Gesellschaft am stärksten.
Fehlende Berücksichtigung sozialer Determinanten
Global und lokal lässt sich Gesundheit nicht auf die Frage der medizinischen Versorgung reduzieren. Die Gesundheit einzelner Menschen und Gruppen ist gleichermaßen eingebettet in verschiedene sozio-ökonomische und politische Bedingungsgefüge. Sie benötigt gesundes Wohnen in einer intakten Umwelt, gute Arbeitsbedingungen, einen sicheren Aufenthaltsstatus, durch gesunde Luft, die Chance auf gute Ernährung und ausreichend Möglichkeiten zur Bewegung. Gesundheit braucht soziale Verhältnisse, die gesellschaftliche Teilhabe, Mitbestimmung und Bildung ermöglichen. Diskriminierungs- und Machtstrukturen müssen dabei ständig berücksichtigt, kritisiert und abgebaut werden.
In Kontrast zur wissenschaftlich gut belegten Bedeutung dieser sozialen Determinanten von Gesundheit steht ihre Bedeutungslosigkeit im aktuellen Gesundheitssystem. Das neoliberale Märchen von Selbstoptimierung, Eigenverantwortung und Priorisierung individueller Risikofaktoren durchdringt alle gesellschaftlichen Bereiche. So wird z.B. jede*r Einzelne für die gesundheitsschädlichen Folgen des Rauchens verantwortlich gemacht, während gleichzeitig jedes Jahr ca. 60.000 Menschen in Deutschland an den Folgen der Feinstaubbelastung sterben. Sozio-ökonomische Lebenswelten, ihre Analyse hinsichtlich gesundheitsschädlicher Aspekte und insbesondere ihre Veränderung in Hinblick auf gesundheitsförderliche Potentiale, spielen im Gesundheitsversorgungsmarkt hingegen kaum eine Rolle. Die Folge ist ein unsolidarisches, undemokratisches und ungerechtes Gesundheitssystem, das an den realen Lebenswelten und Bedürfnissen der Menschen vorbei organisiert wird. So wird zum Beispiel ein Mensch mit einer Herzkreislauferkrankung nicht danach gefragt, ob er schon lange an einer vielbefahrenen Straße mit starker Lärmbelastung wohnt. Stattdessen wird ausschließlich mit Medikamenten behandelt, ohne zugleich Städte autofrei zu machen.
Gegeneinander statt Miteinander
An die Stelle von Solidarität treten in der Folge der Ökonomisierung des Gesundheitswesens Ausbeutung, Konkurrenz, Vereinzelung, Diskriminierung und Ausschluss. An die Stelle des gemeinsamen Kampfes gegen krankmachende Faktoren unserer Arbeits- und Lebenswelt im Sinne einer Verhältnisprävention tritt die Individualisierung von Krankheit: die Einzelnen werden für ihre Gesundheit verantwortlich gemacht.
Insgesamt wird also eine solidarische und partnerschaftliche Kooperation von Akteur*innen im Gesundheitswesen unmöglich gemacht. Die interdisziplinäre und multiprofessionelle Zusammenarbeit unterschiedlicher Gesundheitsberufe (Pflege, Physio-, Logo- und Mototherapie, Ärzt*innen, Hebammen, Psycholog*innen Heilpraktiker*innen etc.) auf Augenhöhe wird – zum Nachteil der Nutzer*innen des Gesundheitssystems – verhindert. Dabei könnte eine derartige Zusammenarbeit in vielen Fällen zu einer nachhaltigeren individuellen Genesung beitragen, wenn etwa Sozialarbeiter*in, Hausärzt*in, Physiotherapeut*in und Vertreter*in des örtlichen Sportvereins zusammen mit einer chronisch lungenkranken Person sowohl die akute medizinische Versorgung wie auch die langfristige Verbesserung der (individuellen) Lebensverhältnisse konzeptionieren und organisieren. So wäre beispielsweise mittels regelmäßiger Atemtherapie und sportmedizinischer Interventionen ggf. eine Reduktion von Medikamenten möglich. Gleichzeitig könnte die Sozialarbeiter*in die erkrankte Person dabei unterstützen, sich mit ihren Nachbar*innen zu organisieren und gemeinsam gegen krankmachende Umweltfaktoren wie Feinstaubbelastung oder Schimmelbefall der Wohnungen vorzugehen.
In der aktuellen Realität des Gesundheitssystems werden hingegen unterschiedliche Fachdisziplinen und Medizinsysteme in ein konkurrierendes Gegeneinander gezwungen, wo ein solidarisches Miteinander geboten wäre. So verhindert etwa die Verdrängung der integrativen Medizin in ein nahezu ausschließlich privat finanziertes Parallelsystem, dass Patient*innen von medizinischen und integrativmedizinischen Ansätzen gleichermaßen profitieren können.
Ertragen statt Mitreden
Die Beteiligung von Nutzer*innen an Entscheidungen bezüglich Diagnostik, Therapie und palliativer Versorgung bleibt im aktuellen Gesundheitssystem häufig auf der Strecke. Zu wenig Zeit für Entscheidungsprozesse und medizinische Fachsprache bilden eine schwer überwindbare Hürde auf dem Weg zu selbst bestimmten Entscheidungen. Die besondere Situation Erkrankter, die Gefühle von Hilflosigkeit, Ausgeliefertsein und Überforderung mit sich bringen kann, bleibt unberücksichtigt.
Profite auf Kosten des Personals
Die kapitalistische Ausrichtung der Gesundheitsversorgung zeigt sich auch in den Arbeitsbedingungen der Gesundheitsarbeiter*innen. Die eigene Berufsethik und das Patient*innenwohl werden unter dem ökonomischen und zeitlichen Druck sekundär. Personalquoten werden an Untergrenzen statt am tatsächlichen Versorgungsbedarf ausgerichtet und widersprechen damit nicht nur dem Recht der Nutzer*innen auf bestmögliche Versorgung sondern auch dem Recht von Gesundheitsarbeiter*innen auf soziale und gerechte Arbeitsbedingungen. Weder die Arbeitsbedingungen noch die Löhne von Gesundheitsarbeiter*innen spiegeln die gesellschaftliche Notwendigkeit und Bedeutung ihrer Arbeit wider. Dies zeigt sich insbesondere im Bereich der Pflege sowie der medizinnahen Dienstleistungen wie etwa Wäschereien, Reinigungsfirmen und Krankenhausküchen.
Das (Gesundheits-)System schließt aus.
Weltweit, aber auch in Deutschland, haben nicht alle Menschen einen (gleichberechtigten) Zugang zu medizinischer Versorgung.
Zum einen wird Menschen schlicht die direkte medizinische Behandlung verwehrt. Für Illegalisierte, Arbeitsmigrant*innen oder andere Menschen ohne Krankenversicherung ist es schwer bis unmöglich, eine medizinische Versorgung in Deutschland zu erhalten. Sie können die Behandlung nicht selbst bezahlen oder riskieren durch einen Ärzt*inbesuch die Abschiebung. Diese Ausschlüsse widersprechen dem Menschenrecht auf Gesundheit, das Deutschland bereits im Jahr 1976 mit der Ratifizierung des UN-Sozialpaktes, anerkannt hat.
Zum anderen werden Ausschlüsse durch Machtverhältnisse (re-)produziert. Der Blick auf Körper, Krankheiten und Lebensverhältnisse ist nach wie vor größtenteils männlich, weiß und auf zwei Geschlechter reduziert. Dadurch werden Menschen, die dieser vermeintlichen Norm nicht entsprechen, ausgeschlossen, benachteiligt und falsch behandelt. Zum Beispiel gibt es weltweit erst seit wenigen Jahren ein Buch über Hauterkrankungen bei Schwarzen Menschen. Bis jetzt wurden Hauterkrankungen nahezu ausschließlich am Beispiel heller Haut gelehrt. (Malone Mukwende, 2020)
Undemokratische Strukturen
Einerseits machen die hierarchischen Strukturen in den Krankenhäusern Gesundheitsarbeiter*innen zu Verwalter*innen eines Dauernotstandes: Zu wenig Zeit, zu wenig Kolleg*innen, zu wenig Anerkennung, fragwürdige medizinische Entscheidungen, all dies gilt es jeden Tag auf`s Neue zu bewältigen und zu kompensieren, ohne dabei das Wohl der Patient*innen aus den Augen zu verlieren.
Andererseits sind die an Profit orientierten Verwaltungs- und Geschäftsstrukturen des Gesundheitswesens zutiefst undemokratisch. Sie verhindern die Mitwirkung von Pfleger*innen, Reinigungskräften, Ärzt*innen und anderen Berufsgruppen an strukturellen Planungen und strategischen Entscheidungen.
Globaler Gesundheitsnotstand
Die beschriebenen Entwicklungen und der aktuelle Status quo unseres Gesundheitssystems beschränken sich nicht auf bestimmte national definierte Gebiete. Vielmehr handelt es sich um globale Phänomene: Weltweit fehlen sichere, kontinuierliche und bezahlbare Zugänge zu Gesundheitsversorgung und Medikamenten. Überall unterliegen die Gesundheitsversorgung, die Arzneimittelforschung und die Entwicklung gesundheitsrelevanter Produkte und Technologien kommerziellen Interessen. Konkrete Gesundheitsbedarfe und Gemeinwohlinteressen spielen eine untergeordnete Rolle. Staatlich geförderte Forschung führt zu patentgeschützten privaten Gewinnen.
Die Klimakrise und ihre Folgen sind ebenfalls globale Phänomene und stellen eine große Gefahr für die Gesundheit und für das Überleben von Menschen weltweit dar. Die gebotenen Schritte zur Eindämmung der globalen Erhitzung stehen hinter ökonomischen und machtpolitischen Überlegungen zurück. Eine wirksame Bekämpfung der Klimakrise und damit die Ermöglichung nachhaltiger und gesunder Lebensbedingungen für Alle werden so verhindert.
Auch in Köln sieht es nicht anders aus
Wir haben in unserem „Kölner Gesundheitsatlas“ (SoliMed, 2020) die Verteilung sozialer Determinanten von Gesundheit, Gesundheitsbedarfen und der Versorgungsdichte in der Stadt analysiert und visualisiert. Hierfür nutzten wir öffentlich zugängliche Daten wie z.B. der Kassenärztlichen Vereinigung, der AOK Nordrhein/Hamburg und des Gesundheitsamtes Köln. Die Datensammlung macht eine Vielzahl an Ungleichheiten deutlich: Die verschiedenen Stadtbezirke weisen große Unterschiede in ihren ökonomischen Verhältnissen auf. Der Zugang zu sauberer Luft, Bildung, Grünflächen, Infrastruktur und Kultureinrichtungen ist sehr unterschiedlich. Ebenso ist die Erreichbarkeit von Strukturen der medizinisch-psychosozialen Versorgung ungleich verteilt. Diese unterschiedlichen Formen von Benachteiligungen betreffen überproportional häufig die gleichen Stadtviertel (z.B. Chorweiler, Mülheim, Porz) und damit immer die gleichen Menschen und haben kumulative Auswirkungen auf deren Gesundheitszustand: So treten chronische Erkrankungen je nach Stadtviertel in unterschiedlicher Häufung auf. Auch die individuelle Lebenserwartung variiert deutlich zwischen den Stadtvierteln. So leben Menschen beispielsweise in Mülheim im Schnitt sechs Jahre weniger als in Lindenthal.
Auf Basis des dargestellten lokalen und globalen Status quo wollen wir Gesundheit und Gesundheitsversorgung radikal neu denken und hin zu einem solidarischen, demokratischen und umfassend gesunden System für Alle verändern – zunächst an einem konkreten lokalen Ort, einem Stadtteilgesundheitszentrum in Köln.
ODER IST DAS SYSTEM DER FEHLER? WAS SOLIMED WILL
Aus unserer vorangegangenen Analyse wird deutlich, dass grundlegende Veränderungen gesellschaftlicher Strukturen nötig sind. Wer gesunde Lebensverhältnisse für alle Menschen will, muss das Thema Gesundheit zu einem grundlegenden Prinzip gesellschaftlicher Entwicklung machen und in alle Politikbereiche (Bildung, Umwelt, Arbeit, Wirtschaft, Stadtplanung, etc.) einbringen.
Wir setzen uns für eine solidarische Verteilung der Ressourcen und eine gute Gesundheitsversorgung für Alle ein. Mit der Gründung eines gemeinwohlorientierten Stadtteilgesundheitszentrums (SGZ) wollen wir einen konkreten Schritt in diese Richtung machen. Dazu vernetzen wir uns mit den bereits vorhandenen Strukturen im Stadtteil (Bürgerzentren, Selbsthilfegruppen, Angebote medizinischer Versorgung, politische Gruppen, Stadtteilkonferenzen, kulturelle Einrichtungen, Sportvereine, migrantischen Selbstorganisationen etc.) und vermeiden dadurch Doppelangebote.
In unserem Stadtteilgesundheitszentrum werden die individuellen Schwierigkeiten, Nöte und Interessen der Stadtteilbewohner*innen wahrgenommen. Gemeinsam suchen wir nach Lösungen. Krankmachende Bedingungen auf die Gesundheit werden aufgespürt und einbezogen. Alternativen werden entwickelt und erprobt.
Wir treten für eine Gesundheitsversorgung unabhängig von Profit-Interessen ein. Der Ökonomisierung setzen wir ein Bild von Gesundheit und Gesundheitsarbeit entgegen, in dem der Mensch und seine Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen. Unsere Vorstellung lässt sich wie folgt zusammenfassen.
Profit-Interessen werden zugunsten der Prinzipien der Humanität, Parteilichkeit und Partizipation ersetzt.
Konkret kann dies zum Beispiel bedeuten, das duale Krankenkassensystem zugunsten einer gemeinsamen Finanzierung von Gesundheitsleistungen abzuschaffen. Auch werden in unserer Vorstellung einer guten Gesundheitsversorgung Erkrankungen bedarfsgerecht und unabhängig vom (vorhandenen oder nicht vorhandenen) Krankenversicherungsstatus behandelt. Patient*innen sind dabei von Beginn an als aktive Entscheider*innen in den Diagnose- und Behandlungsprozess eingebunden. Entscheidend für eine Diagnostik oder Therapie ist nicht deren finanzielle Lukrativität, sondern die physischen, psychischen und sozialen Belastungen eines gesundheitlichen Problems für die betroffene Person.
Uns ist bewusst, dass Zugangsbarrieren zu Gesundheitsleistungen vielfältig sein können und vielfältige Antworten brauchen.
Unser Stadtteilgesundheitszentrum bietet einen möglichst barrierearmen Zugang und achtet auf z.B. räumliche, sprachliche oder kulturelle Barrieren. In unserer Arbeit und unserem Miteinander werden wir sensibel und selbstkritisch hinsichtlich verschiedener Formen von Diskriminierung sein. Wir werden den Blick für mehr Perspektiven auf Körper, Geschlecht, Gesundheit und Krankheit öffnen.
Die Einzelnen finden hier die Möglichkeit, ihre Schwierigkeiten anzusprechen und gemeinsam mit Anderen nach Lösungen zu suchen und eigene Ressourcen zu entdecken und zu stärken. Wo Selbsthilfe möglich ist, wird sie unterstützt. Wo nötig, wird Hilfe organisiert. Unser Stadtteilgesundheitszentrum arbeitet somit nach dem Empowerment-Prinzip.
In unserem Stadtteilgesundheitszentrum erhalten alle Menschen Zugang zu Gesundheitsversorgung unabhängig von ihrem Versicherungs- und Aufenthaltsstatus. Über die Unterstützung von Einzelfällen hinaus entwickeln wir kollektive Lösungsstrategien für gemeinsame Problemlagen mit dem Ziel krankmachende Lebens- und Arbeitsbedingungen zu verändern. Hierfür ist es zunächst notwendig, gemeinsame Problemlagen im Viertel mit den Bewohner*innen zu identifizieren. Die entsprechenden Lösungsstrategien können von einem Ausbau der Fahrradwege über Strategien zur Lärm- und Schadstoffbeseitigung bis hin zu Veränderungen unseres Wirtschaftssystems reichen. Das Prinzip der Partizipation gewährleistet, dass die professionellen Strukturen nicht über die Köpfe der Betroffenen hinweg agieren.
Im Stadtteilgesundheitszentrum arbeiten verschiedene Professionen berufsübergreifend und integrativ zusammen: Community Nurses, Sozialarbeiter*innen, Hausärzt*innen, Medizinische Fachangestellte, Psychotherapeut*innen, Gynäkolog*innen, Jurist*innen, Hebammen und andere bilden ein Team. Die Mitarbeitenden entscheiden in einem kollektiven Miteinander und handeln nach außen und innen solidarisch. Auf diese Weise gehen wir kritisch mit Machtunterschieden um und entwickeln gesündere Arbeitsbedingungen. Zu gesünderen Arbeitsbedingungen zählen unter anderem selbstbestimmtes Arbeiten, unbefristete Beschäftigung, konstruktiver Umgang mit Fehlern und Stresssituationen, große Einfluss- und Gestaltungsspielräume, sicheres Einkommen, Anerkennung und gegenseitige Unterstützung.
In regelmäßigen Plena und Supervisionen reflektieren und hinterfragen wir kontinuierlich unsere Arbeit. Interdisziplinäre Fallbesprechungen sowie gemeinsame und gegenseitige Fortbildungen stärken den integrativen Aspekt unserer Arbeit.
Den Klimawandel im Blick arbeiten wir bewusst ressourcenschonend und treten dafür ein, dass dieses Prinzip im gesamten Stadtteilgesundheitszentrum und darüber hinaus Anwendung findet.
Ein Stadtteilgesundheitszentrum ist nie fertig und bei weitem nicht genug: Wir werden uns kontinuierlich weiterentwickeln, sehen unser Projekt als offenen Austausch mit der Gesellschaft und damit als dynamischen und flexiblen Ort. Wir wollen mehr werden und weitere Stadtteilgesundheitszentren gründen.
